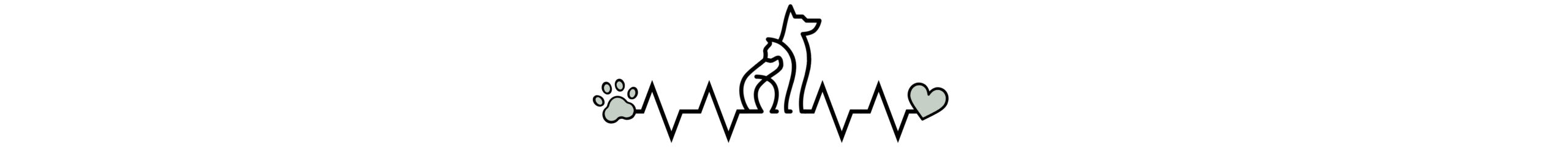Im letzten Beitrag ging es um die angeborenen Verhaltensweisen unserer Haustiere. Natürlich sind die Verhaltensweisen, die automatisch nach der Geburt vorhanden sind, noch nicht das „Ende der Fahnenstange“. Genau wie wir Menschen können auch die Tiere neue Verhalten erlernen.
Zum Beispiel können durch Gewöhnung, Nachahmung, Spielen und besonders durch Konditionierung neue Verhalten erlernt werden. Die einfachste Form ist das Lernen durch Gewöhnung: Reagiert der Hund nicht mehr auf zuvor erlernte und gekonnte Befehle wie „Aus!“, hat eine Gewöhnung stattgefunden. Der Hund hat bemerkt, dass eine fehlende Reaktion auf den Befehl für ihn keine negativen Konsequenzen zur Folge hat – außer möglicherweise ein Anfall von wüsten Beschimpfungen, die den Hund aber wenig tangieren.
Gerade in den ersten Lebenswochen werden wichtige Sozialverhalten durch Umgang mit der Mutter und den Geschwistern gelernt. Deshalb ist es äußerst wichtig, dass die Welpen nicht zu früh von der Mutter und den Geschwistern getrennt werden, da dies sonst später einen negativen Einfluss auf das Sozialverhalten zur Folge haben kann. Das gemeinsame Spielen hat großen Einfluss auf die motorische, geistige und soziale Entwicklung der Tiere. Im Spiel werden der Umgang mit Artgenossen gelernt und Verhaltensweisen getestet, die Muskelfunktionen trainiert und auch Bewegungsabläufe gelernt. Diese Erfahrungen sind unentbehrlich. Tiere, denen diese verwehrt bleiben, können im späteren Leben Verhaltensstörungen entwickeln. Umgekehrt können Tiere, die über Lernen durch Spielen gefördert wurden, einfacher lernen und sich schneller an neue Situationen anpassen.
Aber wie werden dem Hund Befehle beigebracht? Die bekannteste Methode ist die klassische Konditionierung. Dabei wird ein ursprünglich neutraler Reiz mit einem bestimmten Ereignis in Verbindung gebracht. Der russische Psychologen Iwan Pawlow führte Ende des 19. Jahrhunderts ein Experiment durch, das die klassische Konditionierung verständlich macht: Das Zeigen von Futter (=Reiz) hat bei hungrigen Hunden Speichelfluss ausgelöst (=Reflex). Pawlow wollte herausfinden, ob auch ein anderer, bislang neutraler Reiz diesen Reflex auslösen kann. Der neutrale Reiz war in seinem Experiment das Aufleuchten einer Glühbirne, auf das Hunde unter normalen Umständen nicht mit Speichelflussreflex reagieren. Er beobachtete in einem isolierten Raum, dass der Hund beim Anblick von Futter mit Speichelfluss reagierte, beim Aufleuchten der Glühbirne wie erwartet nicht. Dann ließ Pawlow die Glühbirne aufleuchten, und zwar jeweils kurz bevor er dem Hund das Futter präsentierte. Nach einiger Zeit reagierte der Hund bereits beim Aufleuchten der Glühbirne mit Speichelfluss. Er hat gelernt hat, dass das „Lichtsignal“ eine Belohnung zur Folge hat und deshalb den bislang neutralen Lichtreiz mit dem Ereignis „Futter“ verbunden. Wichtig ist, dass bei der klassischen Konditionierung ein Reiz erlernt wird und kein Verhalten. Auf diesem Lernvorgang beruht auch das bekannte „Klickertraining“, das in der Hundeerziehung oft zur Anwendung kommt. Der bedeutungslose „Klick“ wird mit einem positiven Ereignis verbunden und stellt in dem oben aufgeführten pawlowschen Experiment das Lichtsignal dar.
Anders als bei der klassischen Konditionierung wird bei der operanten und instrumentellen Konditionierung ein bestimmtes Verhalten erlernt. Diese Lernform wird auch als Lernen durch Konsequenzen bezeichnet. Bei der operanten Konditionierung wird ein zufälliges Verhalten (Lernen durch Versuch und Irrtum) mit einer positiven oder auch negativen Konsequenz verbunden. Darauf folgt die instrumentelle Konditionierung, in dem das durch Zufall Erlernte (operante Konditionierung) gezielt angewendet wird, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Die operante Konditionierung wird gerne in der Hundeerziehung angewandt, indem erwünschtes Verhalten gelobt und unerwünschtes bestraft wird. Abhängig von der erfahrenen Konsequenz wird das Tier das Verhalten zukünftig öfter oder seltener bzw. gar nicht mehr zeigen. Ein Beispiel: Der Hund bringt seinem Herrchen die Zeitung, der sich darüber sehr freut und den Hund, ggfs. auch mit einem Leckerchen belohnt. Wiederholt sich das, verknüpft der Hund das Zeitungholen mit einer positiven Reaktion und wird das gerne und häufig wiederholen.
Bei der instrumentellen Konditionierung, die auch Lernen am Erfolg bezeichnet wird, führt das Tier ganz gezielt ein bestimmtes Verhalten aus, um ein bekanntes Ziel zu erreichen.
Da es sich bei jeder Konditionierung um erlerntes Verhalten handelt, kann es auch wieder „gelöscht“, also verlernt werden. Das heißt, dass auch schlechte Erfahrungen, die beispielsweise durch eine operante Konditionierung stattgefunden haben, wieder abgewöhnt werden können.